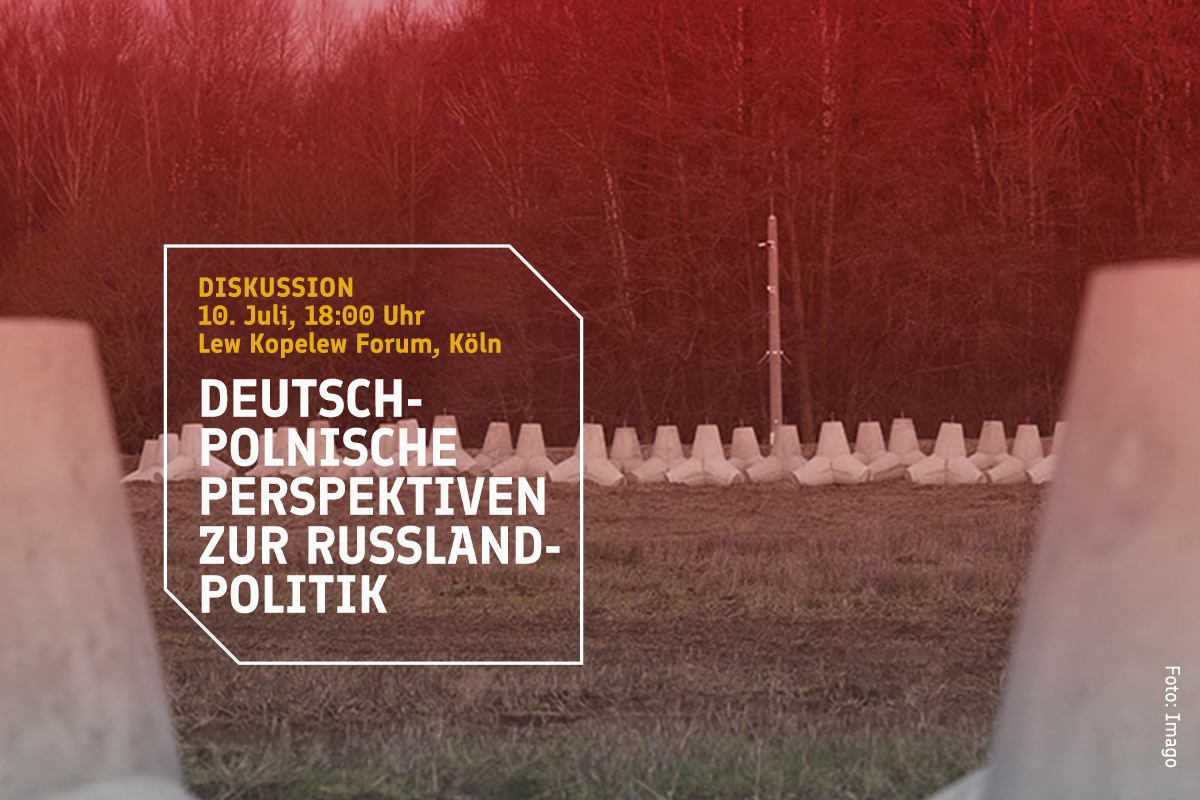Deutsch-polnische Plädoyers für eine neue Russlandpolitik

Jan Tombiński und Irene Hahn-Fuhr (Foto: Tobias Kunz, LibMod)
Warum sollen Polen und Deutschland ausgerechnet jetzt in der Russland-Politik zusammenarbeiten? Weil es höchste Zeit für entschlossenes europäisches Handeln ist. Das bisherige Zögern hat Russland gestärkt und den Krieg verlängert. So lautet eine Kernbotschaft von der Präsentation des LibMod-Strategiepapiers „The Russian Challenge“ (Herausforderung Russland), das von Experten aus beiden Ländern verfasst wurde.
Zur Einführung sagte LibMod-Gründer Ralf Fücks, dass Russland über Jahrhunderte ein definierender Faktor für die deutsch-polnischen Beziehungen gewesen sei. Die Achse Berlin-Moskau, der alte Traum der deutschen Antiliberalen von rechts wie von links, sei für Warschau ein Albtraum. Dafür müsse man nicht auf die polnischen Teilungen und den Hitler-Stalin-Pakt zurückgehen. Viel zu lange habe die bundesdeutsche Politik auf Polen und die anderen Staaten Mittel- und Osteuropas herabgeschaut, während sich der Blick nach Russland richtete.
Aus all diesen Gründen sei es höchste Zeit, ein neues Kapitel der deutsch-polnischen Zusammenarbeit aufzuschlagen:“ Die Politik gegenüber Russland – und aktuell gegenüber der Ukraine – ist dafür der Lackmustest,“ betonte Fücks zu Beginn der von LibMod-Geschäftsführerin Irene Hahn-Fuhr moderierten Präsentation.
Der polnische Geschäftsträger in Berlin, Jan Tombiński, lobte das Papier als „realistisch“, weil es angesichts Russlands Ziele die richtigen Schlüsse ziehe. Er erinnerte an den ehemaligen Putin-Berater Gleb Pawlowski, der einmal gesagt hatte, Russland wolle nicht wie der Westen werden, sondern der Westen solle wie Russland werden. Schon deshalb müsse ein Sieg Russlands weitaus mehr Angst auslösen als eine Niederlage, erklärte Tombiński.
Witold Rodkiewicz vom Warschauer Zentrum für Oststudien (OSW), der gemeinsam mit Fücks die Einleitung geschrieben hatte, zählte weitere Argumente auf: Ein militärischer Sieg werde Moskau veranlassen, die NATO mit noch härteren Forderungen als Ende 2021 zu konfrontieren. Dies werde die Kriegsgefahr in Europa massiv vergrößern. Außerdem müsse mit einer riesigen Fluchtwelle aus der Ukraine nach Westen gerechnet werden.
Ernest Wyciszkiewicz vom Mieroszewski-Zentrum, der gemeinsam mit dem Sonntags-FAZ-Journalisten Konrad Schuller das erste Kapitel geschrieben hatte, argumentierte, dass man in Deutschland zwar inzwischen zugestehe, dass Polen in seiner Einschätzung Russlands richtig gelegen habe, wie der 24. Februar 2022 schmerzlich zeigte. Aber daraus würden keine Schlüsse für das Heute gezogen. Erneut weiche man in Berlin und Warschau in der Bewertung dessen ab, womit man es in Russland zu tun habe. Und erneut wolle man in Berlin die polnische Sichtweise nicht ernst nehmen.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDie Schwäche des Westens ist Russlands Stärke
OSW-Experte Robert Pszczel, der von 2010 bis 2015 NATO-Vertreter in Moskau war, beschrieb den Unterschied so: Während Polen massiv in die Landes- und Bündnisverteidigung investiere, spreche man in Deutschland von „Besonnenheit“. In Moskau würden die Defizite der deutschen Verteidigungsfähigkeit genau registriert und die Debatte über die Ertüchtigung der Bundeswehr minutiös beobachtet. Kürzlich habe der Moskauer Militärexperte Dmitri Danilow sogar explizit gefordert, die von Verteidigungsminister Pistorius geplanten Reformen zu verhindern.
Pszczel, Koautor des dritten Kapitels, stellte stellvertretend für die Autoren Gustav Gressel und Jacek Tarocinski Kapitel zwei (militärische Sicherheit) vor und betonte, dass Deutschland alles tun müsse, um die Bundeswehr schlagkräftiger zu machen. Die Schwäche des Westens sei Russlands Stärke.
Zu Kapitel drei – Russlands hybride Kriegsführung – betonte der deutsche Koautor Arndt Freytag von Loringhofen, von 2020 bis 2022 deutscher Botschafter in Polen, dass die Zeit vor der Bundestagswahl im Februar eine Schlüsselphase für russische Einflussnahme in Deutschland sei. Deshalb müsse aktiver gegen Russland kommuniziert werden, die Medienkompetenz der Bevölkerung gestärkt und Fähigkeiten für Gegenspionage ausgebaut werden, sagte Freytag, der von 2007 bis 2010 BND-Vizepräsident war. Deutschland und Polen seien hier näher aneinander gerückt und hätten eine „gute Basis für Zusammenarbeit“.
Der Bundestagsabgeordnete Robin Wagener, Berichterstatter der Grünen-Fraktion für die Ukraine und Russland, lobte das Kapitel als gute Erklärung dafür, dass die Bedrohung aus Russland „unmittelbar uns“ gelte und nicht stark genug wahrgenommen werde, auch weil „in der politischen Spitze das oberstes Ziel gilt, uns rauszuhalten.“ Nötig sei aber „mehr Selbstüberzeugung, dass die liberale Demokratie es wert ist, verteidigt zu werden.“

Julian Hinz vom Kiel Institut für Weltwirtschaft (im Foto oben), der gemeinsam mit der OSW-Expertin Iwona Wisniewska Kapitel vier verfasst hatte, sagte, dass die Sanktionen bereits erheblich wirtschaftliche Problem für Russland geschaffen hätten. Zwar könnten die Maßnahmen die russische Wirtschaft nicht zum Zusammenbruch führen, doch sei ihrer Wirksamkeit noch steigerungsfähig. So sollte die EU den „Eurasian Roundabout“, also Lieferungen nach Russland über Drittstaaten, schärfer bekämpfen, indem die beteiligten Handelsfirmen sanktioniert werden.
Frieden mit Russland nur ohne Putin
OSW-Expertin Maria Domańska, die mit LibMod-Programmdirektorin Maria Sannikova-Franck das fünfte Kapitel geschrieben hatte, betonte, dass dauerhafter Frieden mit Russland nur nach Putin möglich sei. Ein Regimewechsel in Moskau könnten zwar nur die Russen selbst erreichen, der Westen könne aber helfen, die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Die verbreitete Angst vor einem drohenden Chaos in Russland sei verständlich, wiege aber angesichts der direkten Bedrohung durch das bestehende Regime weniger schwer. Die Erfahrung der 1990er Jahre zeige, dass die Sicherung der Nuklearwaffen auch in chaotischen Umbrüchen funktioniert habe.
Das Zögern des Westens verlängert den Krieg
Fücks fasste die Schlussfolgerungen zusammen: Die Zögerlichkeit des Westens mache Russland stärker und verlängere den Krieg. Europa müsse eigenes militärisches Potential aufbauen, auch um künftiges US-Engagement zu sichern. Eine europäische „Koalition der Willigen“, die sich derzeit zwischen Polen, Balten und nordischen Staaten herauskristallisiert, könne die Handlungsfähigkeit stärken, dürfe aber keine Alternative zu europäischer Sicherheitspolitik und NATO sein. Gerade das Militärbündnis sei für die Ukraine immens wichtig, Kyjiw müsse so bald wie möglich eine Einladung zum Beitritt erhalten.
![]()
Das deutsch-polnische Strategiepapier „The Russian Challenge“ wurde im Rahmen der Projekts „Neue Russlandpolitik und Unterstützung der russischen Zivilgesellschaft“ vom Auswärtigen Amt unterstützt.

Hat Ihnen unser Beitrag gefallen? Dann spenden Sie doch einfach und bequem über unser Spendentool. Sie unterstützen damit die publizistische Arbeit von LibMod.
Wir sind als gemeinnützig anerkannt, entsprechend sind Spenden steuerlich absetzbar. Für eine Spendenbescheinigung (nötig bei einem Betrag über 200 EUR), senden Sie Ihre Adressdaten bitte an finanzen@libmod.de
Verwandte Themen
Newsletter
#mc_embed_signup{background:#b20062; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }
/* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.
We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */
Mit unseren Datenschutzbestimmungen erklären Sie sich einverstanden.